Sind wir ein Partner, auf den im Notfall Verlass ist? Unsere Kunden sagen ja und haben uns überdurchschnittlich stark beurteilt. Mit dem Gesamturteil "Sehr Gut" zählen wir laut FocusMoney zu den "Fairsten Schadenregulierern". Noch mehr Vorteile:
- Bis zu 50 % Rabatt bei Kernsanierung2
- Neuwertversicherung – Dein Haus ist nie unterversichert
- 24 Stunden Kunden- und Schaden-Service
- Infos zum Status Deines Schadens per SMS / E-Mail
Wenn ein Sturm das Dach abdeckt, dann kommt die Wohngebäudeversicherung für die Reparatur auf. Die Wohngebäudeversicherung ist grundsätzlich keine Pflicht. Hauseigentümer entscheiden freiwillig, gegen welche Risiken sie sich absichern möchten. In bestimmten Fällen, wie bei der Finanzierung einer Immobilie, kann die Wohngebäudeversicherung jedoch vorgeschrieben werden. Im Ratgeber erfährst Du, weshalb die Wohngebäudeversicherung für jeden Hausbesitzer wichtig ist. Informationen zur Wohngebäudeversicherung von Cosmos Direkt findest Du auf der Produktseite.
Diese Begriffe solltest Du kennen
Wohngebäudeversicherung: Pflicht oder nicht?
Um die Antwort gleich vorwegzunehmen: Die Wohngebäudeversicherung ist keine Pflichtversicherung. Jedem Hauseigentümer wird die Freiheit gelassen, gegen welche Risiken und Gefahren er sich wie und in welchem Umfang absichern möchte. Selbst wenn sich ein Eigentümer gegen eine Wohngebäudeversicherung entscheidet, muss das toleriert werden. Denn die finanziellen Folgen trägt er allein.
Die Gebäudeversicherung ist keine Pflicht, aber besonders wichtig
Der Abschluss einer Wohngebäudeversicherung mag zwar keine Pflicht sein, dennoch gehört sie zu den Versicherungen, die jeder Hausbesitzer unbedingt abgeschlossen haben sollte. Denn sie trägt die Kosten für die Beseitigung und Reparatur von Schäden, die direkt am Gebäude infolge von Sturm und Hagel, Feuer und Leitungswasser entstehen. Der finanzielle Einsatz, um diese zu beheben, kann mitunter enorm sein. Das gilt insbesondere dann, wenn das Haus niedergebrannt ist und nun wieder aufgebaut werden muss.
Leistungen der Wohngebäudeversicherung
Mit der Wohngebäudeversicherung versicherst Du Dein Haus gegen die wichtigsten Gefahren: diese enthält die folgenden Versicherungen:
- Feuerversicherung (Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion)
- Leitungswasserversicherung
- Sturm- und Hagelversicherung
Gegen einen Aufpreis werden auch Zusatz-Bausteine angeboten. Dazu gehört zum Beispiel die Elementarschadenversicherung, die gegen Schäden durch Starkregen, Überschwemmung, Rückstau, Hochwasser, Schneedruck, Lawinen und Erdrutsch, Erdsenkungen, Erdbeben oder Vulkanausbrüchen absichert sowie der Rundum-Schutz für Photovoltaikanlagen.
Erklärvideo zur Wohngebäudeversicherung
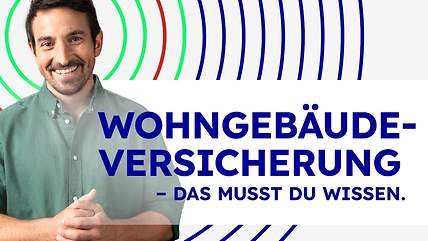
Immobilienfinanzierung: Gebäudeversicherung wird zur Pflicht
Auch wenn für Hauseigentümer die Wohngebäudeversicherung keine Pflichtversicherung ist, gibt es doch Situationen, in denen der Abschluss einer Gebäudeversicherung Pflicht ist. Dies betrifft alle, die ein Haus bauen oder kaufen wollen und dafür eine Finanzierung benötigen. Eine der Bedingungen, damit ein Immobiliendarlehen gewährt wird, ist die Bereitstellung von Sicherheiten durch den Kreditnehmer.
Dabei handelt es sich in der Regel um das Gebäude selbst, das mit einer Grundschuld belastet wird. Das bedeutet: Kann der Bauherr oder der Hausbesitzer den Kredit nicht mehr bedienen, darf die Bank das Gebäude zwangsversteigern, um teilweise oder ganz die Kosten zu tilgen. Damit auch im Fall eines gravierenden Schadens oder Totalverlusts des Hauses die Rückzahlung des Kredits gewährleistet ist, wird die Wohngebäudeversicherung bei einer Finanzierung vorgeschrieben.
Im Schadenfall kann die Bank durch die Versicherungsleistung das Darlehen ausgleichen. Diese wird in der Regel auch als Abtretungsgläubiger in der Police eingetragen. Dadurch erhält zunächst die Bank und erst dann der Hausbesitzer das Geld.
Feuerversicherung war einmal Pflicht
Die Wohngebäudeversicherung hat in einer Pflichtversicherung gegen Feuerschäden ihren Anfang genommen. Brände waren seit jeher eine Gefahr für Dörfer und Städte. Doch in der Neuzeit verschärfte sich das Problem: Die verwendeten Baumaterialien wie Holz waren leicht entflammbar. Bedingt durch das rasante Wachstum der Städte wuchsen die Häuser durch Aufbauten immer enger zusammen. Und da es noch keine Streichhölzer gab, wurden Herde und Feuerstellen rund um die Uhr in Gang gehalten. Kam es zu einer regelrechten Feuerbrunst, war niemand in den noch mittelalterlich anmutenden Städten sicher: So vernichtete der Große Brand von London im September 1666 rund 80 Prozent der damaligen City und machte mehr als 100.000 Menschen obdachlos.
Brandgilden bildeten die ersten Versicherungen
In Deutschland waren die Brandgilden, die im 16. Jahrhundert entstanden, die ersten genossenschaftlichen Versicherungen, die Leistungen bei Brandschäden bereitstellten. Eine derartige Gebäudeversicherung war keine Pflicht-, sondern eine freiwillige Versicherung der Bürger untereinander. Schäden wurde teilweise sogar in Naturalien, sprich Bauholz, ersetzt. 1676 wurde die Hamburger Feuerkasse als erste öffentliche Feuerversicherung eingeführt. Weitere Städte folgten, darunter Berlin und Hannover.
Aus „landesväterlicher Sorge“ führten bald danach auch das Großherzogtum Hessen-Kassel, das Königreich Bayern oder das zum Königreich Preußen gehörige Rheinland eine Feuerversicherung ein. War diese zunächst freiwillig, galt ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Versicherungspflicht. So sollte der Bestand an Gebäuden gegen Feuer besser geschützt werden, die Pflichtversicherung diente aber auch dazu, bestimmte Standards in der Brandprävention durchzusetzen. In anderen Staaten des Deutschen Reiches bildeten sich nach und nach Feuerversicherungsgesellschaften, die gegen Brandschäden versicherten.
Das Ende der Pflichtversicherung kam 1994
Der Abschluss einer Feuerversicherung war beispielsweise in Bayern, Hamburg, Baden-Württemberg und Braunschweig sowie in Teilen von Hessen und Niedersachen bis 1994 gesetzlich vorgeschrieben. Die Versicherung wurde von den öffentlich-rechtlichen Versicherern übernommen, die als Gebäudemonopolversicherer festgeschrieben waren. Infolge der Liberalisierung des Versicherungsmarktes und der Einführung des EU-weiten Binnenmarktes stellte sich die Frage Wohngebäudeversicherung – Pflicht oder nicht ein weiteres Mal. Da jeder Hausbesitzer selbst in der Verantwortung steht und ihm die Wahlfreiheit überlassen werden sollte, wurde dieses Monopol aufgehoben.
Kommt die Pflichtversicherung gegen Hochwasser?
Nach dem verheerenden Hochwasser Mitte 2013 entbrannte eine Debatte, ob der Abschluss einer Gebäudeversicherung inklusive Elementarschutz für Hausbesitzer verpflichtend sein sollte. Das Bundesumwelt- und Bauministerium sowie das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz sprachen sich für eine solche Lösung aus. Die Idee, die hinter dem Vorschlag steht: Durch eine Pflichtversicherung – die nicht nur gegen Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschäden, sondern auch gegen Hochwasser und andere Naturkatastrophen schützt – ließe sich zum einen der Versicherungsschutz in hochwassergefährdeten Gebieten insgesamt stärken, zum anderen würden dadurch auch Anreize zur besseren Schadensprävention geschaffen.
Wie eine Pflichtversicherung aussehen könnte, ist offen. Mehrere Möglichkeiten sind denkbar. Eine Variante ist, dass der Staat Zuschüsse für die Gebäudeversicherung gewährt, wenn sie Pflicht wird. So könnten insbesondere Hausbesitzer entlastet werden, die sich bisher aus finanziellen Gründen gegen eine Gebäudeversicherung entschieden haben. Eine andere Variante ist, vier verschiedene Risikozonen einzuführen. Je nach Standort und Gefahrenlage des Hauses würden die Beiträge aber weit auseinanderliegen: Würde ein Haus in der Risikozone 1 beispielsweise 100 Euro kosten, wären dies in Zone 4 schon 1.600 Euro.
Wohngebäudeversicherung muss trotz Pflicht bezahlbar bleiben
Dies zeigt das zentrale Problem, das noch zu klären ist, bevor eine Gebäudeversicherung Pflicht werden kann: Sie muss bezahlbar bleiben. Zudem bestehen die federführenden Ministerien darauf, dass die Versicherung nur ein Teil der Gesamtlösung sein kann. Verschiedene Schutzmaßnahmen sollen die Entstehung von Schäden schon im Vorfeld verhindern. Dies betrifft nicht nur individuelle Präventivmaßnahmen wie wasserdichte Kellerfenster oder Rückstauklappen, sondern auch bauliche Veränderungen wie Deiche und Polder, die Bund, Länder und Kommunen verantworten.
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weist darauf hin, dass eine Pflichtversicherung nicht notwendig sei. 99 % aller Häuser in Deutschland können gegen Elementarschäden versichert werden. Zudem würden sich Hausbesitzer weniger verantwortlich für präventive Maßnahmen fühlen. Falls die Gebäudeversicherung eine Pflichtversicherung würde, wären auch steigende Beiträge kaum zu vermeiden. Daher hat die Politik die Überlegung ins Spiel gebracht, die Versicherungsprämien auch an Maßnahmen zur Erhöhung der Gebäudesicherheit zu koppeln.
Wichtige Info: Nicht nur Hausbewohner, die in gefährdeten Gebieten in der Nähe von großen Flüssen leben, sind von Hochwasser gefährdet. Wie der GDV auf der Naturgefahrenkonferenz 2014 bekanntgab, ereigneten sich 85 % aller versicherten Hochwasserschäden im Jahr zuvor in Regionen, die keine Hochwassergebiete sind.
Fazit: Wohngebäudeversicherung ist keine Pflicht – aber überaus wichtig
Die Wohngebäudeversicherung ist keine Pflichtversicherung für Hausbesitzer. Nur wenn der Bau oder der Kauf über ein Immobiliendarlehen finanziert wird, kann die Gebäudeversicherung erlangt werden. Dann ist ihr Abschluss zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern Bestandteil der Strategie, mit der sich das Kreditinstitut gegen den Ausfall von Rückzahlungen absichert.
Aber die Wohngebäudeversicherung gehört ohnehin ins Versicherungsportfolio jedes Hausbesitzers. Nur so können das Gebäude, festinstallierte Bauteile sowie Nebengebäude gegen Schäden infolge von Sturm und Hagel, Feuer und Leitungswasser finanziell abgesichert werden. Auch der Einschluss einer Elementarversicherung ist sinnvoll. Dass solche Schäden sehr teuer werden können, zeigen die wiederkehrenden Meldungen von Hochwasserkatastrophen, die auch außerhalb von Risikoregionen auftreten können. Die Wohngebäudeversicherung ist keine Pflichtversicherung, aber eine Mussversicherung für alle Hausbesitzer, um sich vor den finanziellen Folgen schwerer Schäden zu schützen.








